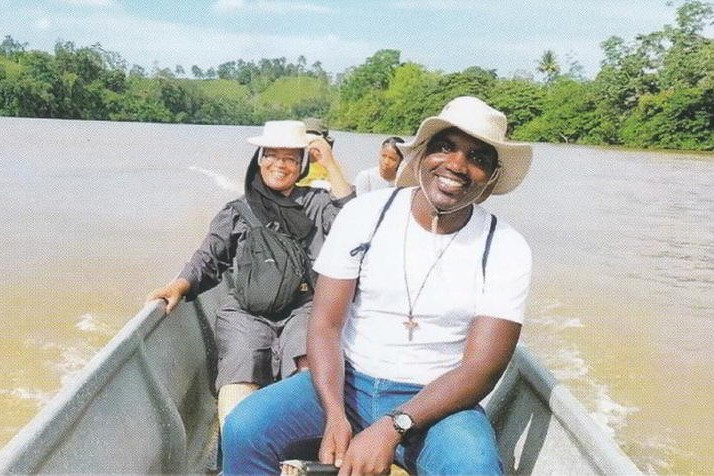Zu den Neuheiten, die uns die Covid-19-Pandemie gebracht hat, gehört, dass sie uns nicht viel Spielraum lässt. In früheren Zeiten, während der Pest, konnte sich jeder nach eigenem Ermessen auch unter Lebensgefahr den Betroffenen widmen. Zu ihnen gehören Menschen, die später zu Heiligen erklärt wurden, wie Louis Gonzaga, König Ludwig von Frankreich oder Daniel Comboni. Aber das ist jetzt verboten.
Wir befinden uns in einer superorganisierten Gesellschaft, die nach wissenschaftlichen Hygienekriterien handelt, und es heißt, dass der beste Weg anderen zu helfen darin besteht, Abstand zu halten, um die Ansteckungsrisiken zu verringern. Dennoch gibt es immer Räume für Großzügigkeit, auch in der Zeit des Coronavirus. Dies alles sage ich aus einer Ecke Afrikas, wo das Coronavirus Gott sei Dank „noch“ nicht stark angekommen ist und wo die herrschenden Isolationsmaßnahmen nicht so drakonisch sind wie in Europa. Aber auch wir sind in vielerlei Hinsicht eingeschränkt durch das Virus, das wie ein Damoklesschwert bedrohlich über unseren Köpfen hängt.
Auf der Mission von Gilgel Beles in Äthiopien lebe ich mit zwei jungen Comboni-Laienmissionaren, einem Spanier und einem Portugiesen, der vor einem Jahr hierherkamen. Das Coronavirus war damals nicht bekannt, und sie wollten voller Begeisterung viele Dinge für die Menschen zu tun. Sie machten sich sofort an die Arbeit, lehrten, was sie unterrichten konnten, und besuchten in den Dörfern die Kranken, um sie ins Gesundheitszentrum zu bringen. Sie arbeiteten wie im Akkord, um das Beste aus dem kurzen zweijährigen Einsatz zu machen.
Dann, unerwartet, sozusagen mitten in der Arbeit, kam das Coronavirus. Viele Organisationen riefen ihre Mitglieder auf, in die Heimat zurückzukehren. Auch die beiden wurden dazu aufgerufen. Wenn sie blieben, war es auf ihre eigene Verantwortung. Und sie zögerten nicht bei der Entscheidung: Sie blieben „auf eigene Verantwortung“, auch wenn die Mutter eines von ihnen vor einer kritischen Krebsoperation steht und sie selbst von anhaltenden Typhusanfällen betroffen sind, die sie schwächen.
Und sie bleiben hier. Wie ich bereits erwähnte, ist es nicht so, dass die Einschränkungen besonders hart wären. Der Bewegungsspielraum ist immer noch recht groß, zumindest solange nicht die ersten Infektionsfälle in unserer Gegend vorkommen. Allerdings hat das ganze Spektrum der Aktivitäten gelitten. Da das akademische Leben völlig gelähmt ist und Treffen verboten sind, können sie keine Gruppen mehr unterrichten, und die Bibliothek, die sie eröffnet hatten, hat keine Besucher mehr.
Trotz all dieser Einschränkungen versuchen sie, bis zum Schluss zu widerstehen. Sie haben die Menschen hier schätzen gelernt, und selbst wenn sie nicht viele Dinge „für sie“ tun können, können sie „bei ihnen“ sein. Und sie haben das Gefühl, dass die bloße Gegenwart in diesen Momenten der Trübsal schon ein Wert ist, der das Kommen und Bleiben so lange wie möglich rechtfertigt.
P. Juan González Núñez