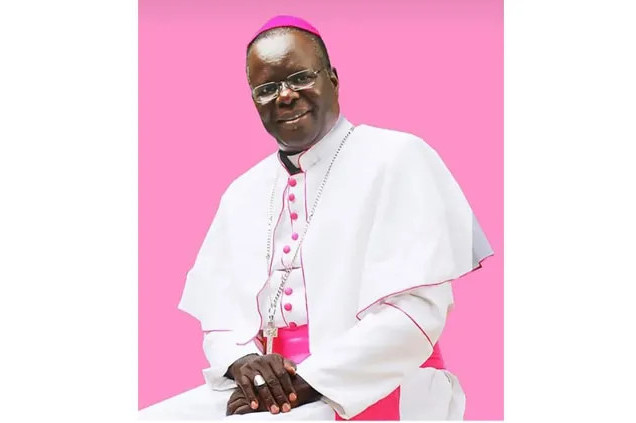Die Situation in der Hauptstadt Juba wird immer gefährlicher – jetzt droht ein Versorgungsnotstand
Es könnte kaum dramatischer klingen, was Bruder Bernhard Hengl mit abgebrochenen Sätzen über das Handy berichtet: Schüsse direkt vor der Missionsstation, Frauen und Kinder in Panik, plündernde Soldaten und Unsicherheit, wohin man schaut. Doch der Missionar will seine Arbeit fortsetzen.
Als vorige Woche die Kämpfe zwischen den Soldaten des Präsidenten Salva Kiir und des Vizepräsidenten Riek Machar in der südsudanesischen Hauptstadt Juba eskalierten, veranlasste das Auswärtige Amt die Evakuierung aller Deutschen. Jetzt sind kaum noch Europäer in der Stadt, sogar die Menschen mit dem Pass des Nachbarstaats Uganda, die in Juba Handel betrieben oder in Firmen arbeiteten, verlassen in aller Eile das Krisengebiet.
Mit ihnen versuchen zehntausende Südsudanesen, die Grenze zu Uganda zu erreichen, weil sie sich im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen. Das berichtet Comboni-Missionar Bruder Bernhard Hengl, der am 8. Juli nach Ellwangen schrieb: „Hubschrauber im Tiefflug mit Maschinengewehren auf beiden Seiten patroullieren die Stadt, seit zwei Stunden schon. Meine Arbeiter haben sich in einem Container verschanzt. Wer irgendwo unterwegs ist, riskiert sein Leben, wird brutal zusammen geschlagen oder mitgenommen.“
Br. Bernhard steht über Telefon und E-Mail Kontakt mit den Comboni-Niederlassungen in Ellwangen. Er arbeitet in Juba für die Bischofskonferenz und leitet den Bau einer Hochschule, mit einfachsten Mitteln, den nötigen Strom liefert ein Dieselaggregat. Weil Lebensmittel und Alltagsgüter immer schwerer zu bekommen sind, hat er für die Missionsstationen der Umgebung eine Versorgung aufgebaut. Immer wieder ist es ihm gelungen, einen Lastwagen mit Mais oder Reis aus Kenia zu ordern.
Bernhard Hengl ist einer von 50 Comboni-Missionaren im Südsudan, darunter fünf Deutsche. Sie versuchen den Menschen durch den Aufbau von Schulen und medizinischer Versorgung etwas Stabilität und Perspektiven zu bringen. Bislang hat die Regierung die Aktivitäten der Missionare toleriert. Wie sich die Situation weiter entwickelt, ist unklar.
In Ellwangen sitzt Bruder Hans-Dieter Ritterbecks, er war in den 90er Jahren selbst als Missionar im Sudan und hat ähnliche Krisensituationen erlebt. Jetzt versucht er, von hier aus die Brüder im Südsudan zu unterstützen. Mit Informationen, mit Kontakten, auch mit Geld, um Hilfs- und Lebensmittellieferungen zu bezahlen. Doch manchmal brauchen Br. Bernhard Hengl und die anderen auch nur eine aufmunternde Stimme aus der Heimat.
„Die Entscheidung, im Krisengebiet zu bleiben oder auszureisen, muss jeder für sich allein treffen“, erklärt er Ritterbecks im Pressegespräch. „Nur wer vor Ort ist, kann die Gefahr einschätzen, nur wer vor Ort ist weiß, ob er noch genug Kraft hat, das auszuhalten.“
Sudan und Südsudan sind für die Comboni-Missionare besondere Länder. Hier hat ihr Ordensgründer Daniel Comboni gewirkt, viele Missionsstationen sind über 100 Jahre alt.
Seitdem auch die meisten Hilfsorganisationen ihr Personal aus dem Südsudan abgezogen haben, ist Br. Bernhard als Interviewpartner für Nachrichtenredaktionen und Presseagenturen gefragt. Was oft nicht bedacht wird: die Einheimischen fühlen sich in solchen Krisen sicherer, wenn noch Ausländer zugegen sind, weil diese die Augen der (westlichen) Öffentlichkeit sind.
Plötzlich läutet Ritterbecks Telefon, es ist Bruder Bernhard. Der Kontakt ist schlecht, bricht immer wieder ab. Doch ich kann ihm jetzt die Frage stellen, die mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt: „Warum gehen Sie das Risiko ein, warum bleiben Sie in Juba, ohne Wachen, ohne Schutz?“
„Hier ist es im Moment besser, keine Bewaffneten um sich zu haben, sich nicht einzumauern. Den Blechzaun um unser Lager kann jeder überwinden, wenn die Soldaten herein wollen, kommen sie auch herein“, sagt er, und fügt hinzu: „Wenn man sich in eine solche Situation begibt, dann weil man das Vertrauen hat, dass man von Gott beschützt wird. Wenn man dieses Vertrauen nicht hat, ist es besser man geht.“
Gerhard Königer
aus: Schwäbische Post, Lokales, von Mittwoch, 20. Juli 2016