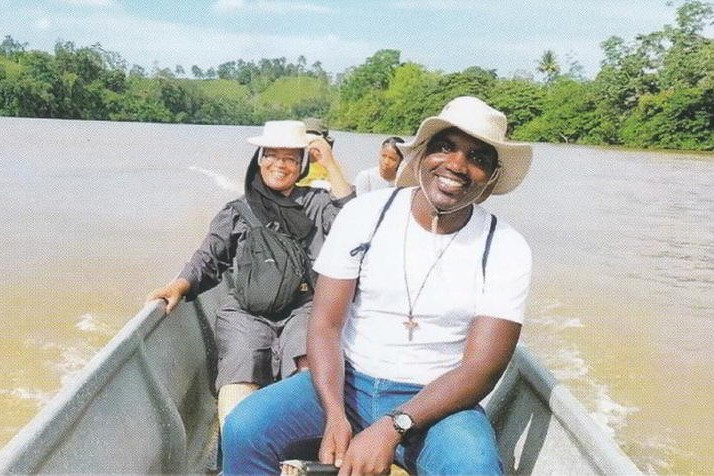Ein „geistiges Vakuum“, das von Omas Tränen gefüllt wird. Eine Pfarrjugendgruppe, die Ruhe bietet und sich für andere öffnet. Und die Entscheidung, sich in das Meer der Mission zu stürzen, die unglaubliche Freude bietet. Bruder Gaspar Abarca Andrés, ein Comboni-Missionar, erzählt uns seine Geschichte.
Ich wurde 1975 in Chilpancingo, der Hauptstadt und zweitgrößten Stadt des mexikanischen Bundesstaates Guerrero, im Südwesten des Landes geboren. Meine Familie war katholisch, aber nur dem Namen nach. Nicht, dass meine Eltern Probleme mit der Kirche hatten, in der sie getauft worden waren, aber sie hatten kein Zugehörigkeitsgefühl und kümmerten sich wenig darum, nach den Lehren der Religion zu leben oder sie zu praktizieren. Sie haben sich auch nicht bemüht, ihren Glauben an mich und meine Brüder weiterzugeben. Sie dachten wohl, dass sich die Mühe nicht lohnen würde. Ich kann mich nicht erinnern, als Kind am Sonntag zur Messe oder zu einer anderen Feier in die Kirche gegangen zu sein. Tatsächlich wuchs ich in einem spirituellen Vakuum auf, das Mama und Papa bei uns zu Hause existieren ließen.
Doch die Natur verabscheut das Vakuum. Ungefüllte Räume sind nicht natürlich, da sie gegen die Gesetze der Natur und der Physik verstoßen. Bald sollte ich lernen, dass dieses „Gesetz“ auch im Bereich der Religion und des Glaubens gilt. Wenn ein Mensch sich mitten in einem emotionalen Vakuum befindet, muss er das Gefühl haben, dass fast alles besser ist als die zermürbende Leere geistiger Einsamkeit.
Irgendwann muss einer meiner Brüder ein solches Gefühl verspürt haben, und er begann ganz unerwartet, an Versammlungen der Zeugen Jehovas teilzunehmen. Eines Tages – ich war gerade fünfzehn Jahre alt geworden – lud er mich ein, ihn zum Gottesdienst in einem nahe gelegenen „Königreichssaal“ zu begleiten. Ich ging mit ihm, aber was ich sah und hörte, beeindruckte mich nicht sehr. Er bestand darauf, dass ich regelmäßig mit ihm gehen sollte. Das tat ich, aber ich brachte es nicht übers Herz, die Einladungen anzunehmen, die ich erhielt, um mich mehr im Leben und der Arbeit dieser christlichen Sekte einzubringen. Irgendwie hat es einfach nicht mit ihnen gepasst.
Eines Tages, als ich aus dem „Königreichssaal“ zurückkam, fand ich meine Großmutter väterlicherseits in Tränen aufgelöst. Ich fragte sie: „Was ist mit dir passiert?“ Als sie mir direkt in die Augen schaute und versuchte, ihr Schluchzen zu unterdrücken, sagte sie: „Das ist genau die Frage, die ich dir stellen möchte: ‚Was ist mit dir passiert?‘ Ich bin sehr traurig, Junge, und ich weine, weil du und dein Bruder etwas ‚draußen‘ suchen, wenn genau das in deiner Nähe ist, ‚innerhalb‘ deines Leben und in dir selbst. Ihr gehört bereits einer Kirche an, und ihr müsst nirgendwo anders hingehen, um das zu finden, was ihr sucht.“
Lange Zeit schwieg sie, doch sie wendete die Augen nicht von mir ab. Der Anblick ihrer Tränen tat mir weh. Der Schmerz, der in ihr sanftes weiches Gesicht geschrieben war, und das heftige Heben und Senken ihrer Brust unter gequältem Schluchzen tadelten mich, und die Verletzungen und die Vorwürfe waren deutlich. Aber ich konnte Liebe, unermessliche Liebe, in ihren Augen sehen. Liebe zu mir und zu meinem Bruder. Als sie die Tränen mit dem Handrücken wegwischte, fuhr sie fort: „Ich gebe dir keine Schuld, Junge. Ich gebe auch deinem Bruder keine Schuld. Ich gebe euren Eltern die Schuld. Sie haben euch ernsthaft Unrecht getan. Sie haben nie versucht, den Schatz, den sie erhalten hatten, an euch weiterzugeben, indem sie euch den katholischen Glauben vermittelten.“ Ich verspürte einen unbändigen Drang, ihren Schmerz zu lindern, und sagte ihr: „Sag es mir, wenn du nächstes Mal in die Kirche gehst, dann werde mit dir kommen.“
Sie tat es am folgenden Sonntag und dem danach, mehrere Wochen lang. Bis sie mich eines Sonntags nach dem Gottesdienst fragte: „Warum bleibst du nicht einfach noch eine Weile hier? Schau dir all diese Jugendlichen an. Sie haben das gleiche Alter wie du. Wahrscheinlich habt ihr einiges gemeinsam. Geh einfach zu ihnen. Ich versichere dir, alles wird gut gehen.“ Sie hatte Recht. Ich blieb an diesem Sonntag und an jedem Sonntag der nächsten sechs Jahre.
Die Jugendgruppe hieß „Shalom“. Man sagte mir, es bedeute „Frieden“. Wir trafen uns jeden Samstag. Sonntags besuchten wir die Messe und führten andere Aktivitäten durch. Die Zeit des Jahres, die mir am meisten gefiel, war die Karwoche, während der die Mitglieder der Jugendgruppe in einer der kleinen christlichen Gemeinden der Diözese eine „Missionserfahrung“ machen konnten. Wir steckten viel Arbeit in die Vorbereitung. An jedem Sonntag der Fastenzeit verbrachten wir den ganzen Vormittag damit, zu organisieren und das enge Programm der einwöchigen Erfahrung ausführlich mit großem Interesse zu studieren. Junge Leute aus anderen Pfarreien schlossen sich uns bei der Vorbereitung an. Zeitweise waren es mehr als 90 Jungen und Mädchen, die alle gerne „in die Mission gehen“ wollten. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese Fastenzeiten, gekrönt von ebenso vielen Karwochen, mich in einen anderen Menschen verwandelt haben.
Der wirkliche Wendepunkt in meinem Leben stand noch bevor. Eines Tages besuchte ein Comboni-Missionar unsere Jugendgruppe. Er sprach von einer „Mission“ der Kirche, die viel weiter ging als das, was wir einmal im Jahr in einer kleinen christlichen Gemeinde unserer Diözese durchführten. „Die Mission der Kirche ist offen für die ganze Welt“, sagte er. Seine Lebensgeschichte war ein greifbares Beispiel dafür.
Was er uns erzählte, blieb mir monatelang im Gedächtnis. Ich war sogar versucht, mit den Comboni-Missionaren Kontakt aufzunehmen, aber meine Schüchternheit hinderte mich daran. Eines Tages ließ ich jedoch etwas bei einem Freund durchsickern. „Ich habe ihre Adresse“, sagte er. Ich schrieb sofort einen Brief. Diesen Tag betrachte ich als Beginn meines „Comboni-Abenteuers“.
Von Anfang an wusste ich, dass ich Bruder werden wollte. Die Inspiration war mir kurz zuvor bei der Lektüre der Geschichte von Mutter Teresa gekommen. Das Buch schilderte eine Anekdote, in der es um das Charisma ihres Instituts ging. Jemand hatte sie gefragt, warum ihre Schwestern nicht viel über Gott sprechen würden. Ihre Antwort entsprach dem, was ich suchte. „Unsere Mission“, sagte sie, „ist es, die Gegenwart und die Liebe Gottes durch unser Handeln und unsere Arbeit zu zeigen“. Ja, jetzt konnte ich in Worte fassen, was ich wollte: Gottes Gegenwart in der Welt durch mein Werk und mein Handeln zeigen, nicht durch Predigten.
Ich trat den Comboni-Missionaren im September 1998 bei und begann mit dem Postulat, der ersten Ausbildungsphase. Drei Jahre lang besuchte ich die Krankenpflegeschule an einer nahegelegenen Universität. Während der zwei Jahre des Noviziats musste ich die Universitätskurse unterbrechen. Nachdem ich im Mai 2003 meine zeitlichen Gelübde abgelegt hatte, ging ich zurück an die Universität Monterrey, wo ich den Bachelor of Science in Krankenpflege erlangte.
2005 wurde ich für drei Jahre ins Comboni-Brüderzentrum von Nairobi geschickt, um meine Grundausbildung zu absolvieren. Es war nicht einfach für mich, in ein neues kulturelles Umfeld zu kommen, in einer multikulturellen Gemeinschaft zu leben und neue Sprachen zu lernen. Genaugenommen war es eine große Herausforderung. Doch Gott sei Dank endete im Mai 2008 meine Grundausbildung. Und es gab ein großes Geschenk für mich: Ich wurde zu meiner ersten Mission im Südsudan entsandt.
Nach einem dreimonatigen Heimaturlaub in Mexiko kam ich im September in Juba an, wo ich einige Monate zur Akklimatisierung blieb, bevor ich zur Mission von Mapuordit, 75 Kilometer südwestlich von Rumbek, geschickt wurde. Der Anblick des Mary Immaculate Mapuordit Hospital ließ mein Herz höher schlagen. Endlich war ich an dem Ort angekommen, wo ich „die Gegenwart und die Liebe Gottes durch mein Werk zeigen“ konnte und in einer „Sprache“, die jeder deutlich verstehen würde.
Ich arbeitete zuerst in der medizinischen Abteilung, und es war großartig. Wenige Monate später bat mich der zuständige Arzt, auf die chirurgische Station zu wechseln, um im Operationssaal als OP-Krankenpfleger zu helfen, und es war erstaunlich. Oft musste ich abends, an Wochenenden, Feiertagen und nachts für Notoperationen, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche stattfinden können, „auf Abruf“ bereitstehen. Wie wunderbar ist es, jederzeit und unter den unterschiedlichsten Umständen „die Botschaft vermitteln“ zu können! Ich schrieb an meine Oma: „Deine Tränen haben sich in die kostbarsten Perlen verwandelt.“
Im Januar 2012 ging ich wieder auf Urlaub nach Hause. Am 28. legte ich die Ewigen Gelübde in meiner Heimatgemeinde ab. Meine Eltern waren stolz auf mich. Meine Großmutter weinte während der ganzen Zeremonie, aber dieses Mal waren es Freudentränen.
Die Anforderungen des Mapuordit-Krankenhauses hören nie auf, und man muss sich in manches verwandeln, vom Babysitter bis zum Anästhesisten. Im Jahr 2010 ging ich auf Drängen des Anästhesisten, der mir half, die Grundlagen seiner medizinischen Kunst zu erlernen, für ein paar Monate ins Lacor Hospital, Uganda, um eine Fachausbildung zu absolvieren. Jetzt gerade mache ich einen Vollzeitkurs in Anästhesie im Krankenhaus Mulago in Kampala. Aber mit dem Herzen bin ich immer im Mapuordit Hospital, wohin ich bald zurückkehren werde.
Bruder Andrés Gaspar Abarca