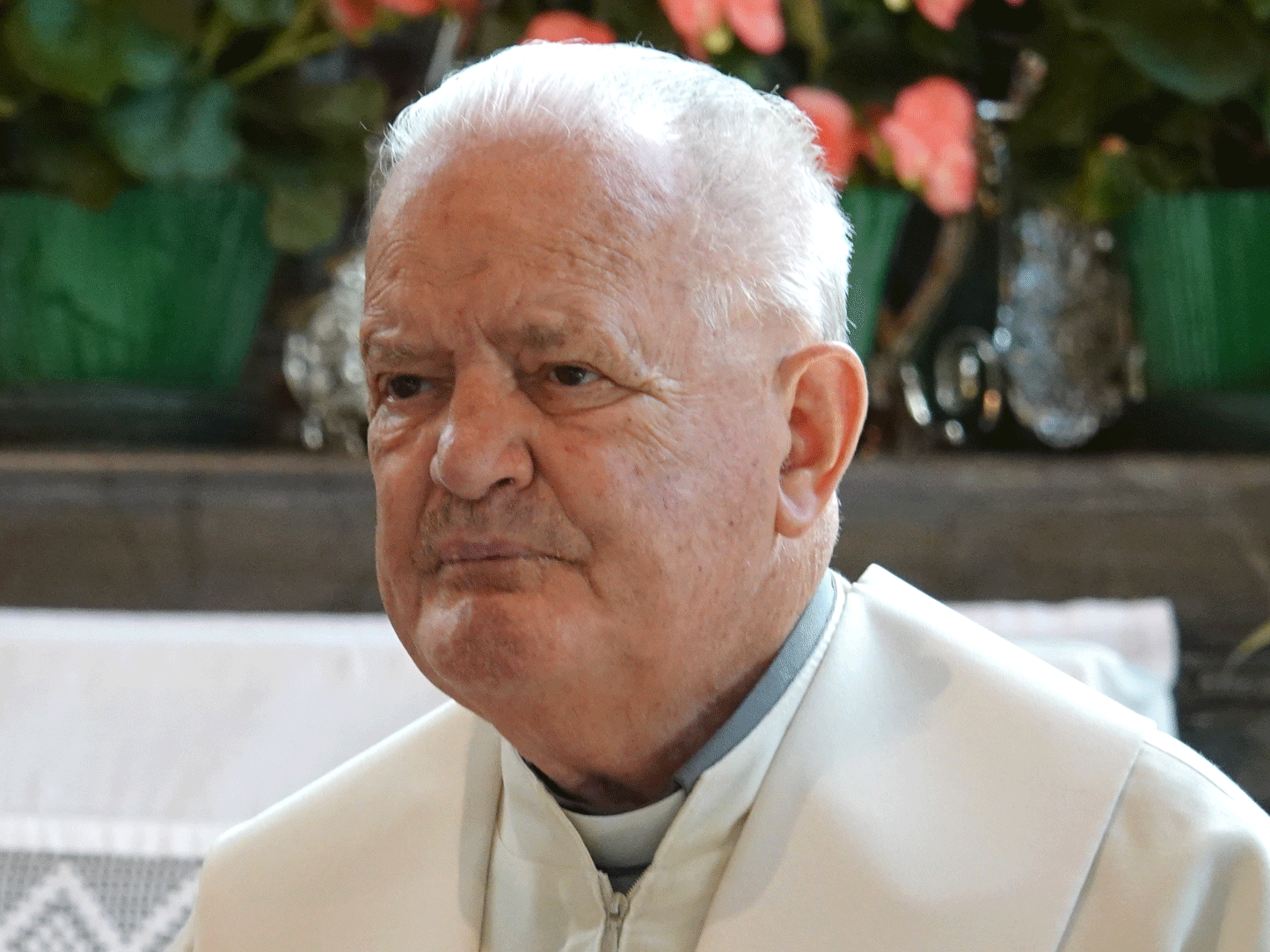Pater Donald Maripe Magoma, ein Comboni-Missionar aus Südafrika, ist während seiner Ausbildung und bei seiner Arbeit auf viele Hindernisse gestoßen. Ein Ende ist nicht in Sicht, aber er hat nie aufgegeben.
Ich wurde 1979 in Masikwe in der Diözese Witbank (Südafrika) geboren. Der Besuch der Kirche war die ausschließliche Angelegenheit meines Vaters. Obwohl er Pastoralassistent in einer der Tausenden von „apostolischen Kirchen“ war, von denen es in Südafrika wimmelt, machte er sich nie die Mühe, seine Kinder sonntags mitzunehmen. Unsere Mutter hingegen gehörte keiner Kirche an und praktizierte auch keine Religion.
Das änderte sich 1990, als unsere Eltern uns in der Obhut unserer Tante mütterlicherseits, Jane, ließen, die eine überzeugte Katholikin war. Für sie war es eine Selbstverständlichkeit, uns mit in die Kirche zu nehmen. So kam es, dass ich mit dreizehn Jahren das Katechumenat in der Nachbargemeinde begann. Meine älteste Schwester wollte nicht zurückstehen und trat ebenfalls ein. Zwei Jahre später wurden wir getauft und gefirmt. Nach uns wollten auch die anderen Geschwister den gleichen Weg gehen. Eines schönen Tages beschloss zu unserer Überraschung auch Mama, katholisch zu werden, und Papa brauchte nicht lange, um ihr zu folgen.
Kurz vor meiner Taufe im Jahr 1994 kam der Diözesanbeauftragte für Berufungspastoral in unsere Gemeinde, um über die verschiedenen Berufungen in der Kirche zu sprechen. Er wies nachdrücklich auf den dringenden Bedarf unserer Diözese an Priestern hin. Er sagte uns: „Unsere Diözese umfasst ein riesiges Gebiet, das von so vielen Menschen bewohnt wird, aber sie hat nur drei Ortspriester“. Ich kann versichern, dass ich die Bedeutung seiner Rede nicht ganz begriffen habe, aber ich verließ dieses Treffen mit dem Gedanken, dass es wichtig war, dass jemand der vierte Priester der Diözese Witbank wurde.
So fing ich bald nach der Taufe an, alle von der Pfarrei organisierten Berufungsworkshops zu besuchen, immer getrieben von dem halbherzigen Wunsch, der vierte Priester der Diözese zu werden. Wie es der Zufall wollte, verließ der Berufungsbeauftragte der Diözese Südafrika bald darauf, da er von seinen Vorgesetzten in sein Heimatland zurückgerufen wurde, und es dauerte lange, bis der Bischof einen Priester fand, der seinen Platz einnahm.
Eines Tages stieß ich zufällig auf eine Zeitschrift, die von den Comboni-Missionaren in Südafrika herausgegeben wurde: „Worldwide“. Der Inhalt der Artikel und die Perspektive, die ich in den vielen darin geschilderten Zeugnissen erkennen konnte, überraschten mich zutiefst: Es ging nicht mehr darum, Priester für eine Diözese zu finden, wie groß und arm sie auch sein mochte, sondern für die ganze Welt, die unendlich viel größer war. Mir war sofort klar, dass der Bedarf der Welt an Verkündern des Evangeliums viel größer war als der der Diözese.
Bald fragte ich eine Schwester, die in der Pfarrei arbeitete, ob sie die Adresse des Berufungsbeauftragten dieser Kongregation wisse. Sie schrieb sie auf einen Zettel und gab ihn mir mit den Worten: „Du solltest wissen, dass die Berufung zum Missionar viel anspruchsvoller und herausfordernder ist als die Berufung zum Diözesanpriester. Du musst deine Heimat, dein Land, deine Nation verlassen und dorthin gehen, wohin Gott dich schickt“. Die Herausforderung reizte mich: Ich würde nicht der vierte Priester meiner Diözese sein, sondern einer dieser „verrückten“ Menschen, die alles zurücklassen, um in die Welt hinauszugehen und Jesus und seine Botschaft zu verkünden.
Ich schrieb an den Berufungsbeauftragten der Comboni-Missionare. Innerhalb weniger Monate war die Entscheidung gefallen. 1997 trat ich in Pretoria als Anwärter in das Postulat ein. Zwei Jahre später begann ich das eigentliche Postulat. Im Jahr 2001 trat ich in das Noviziat in Lusaka (Sambia) ein. Es war das erste Mal, dass ich außerhalb meines Heimatlandes war, und ich war der einzige Südafrikaner in der Gruppe der Novizen.
Die zwei Jahre des Noviziats verliefen reibungslos. Im April 2003 legte ich meine erste Ordensprofess ab. Kurz darauf kam ich in das Scholastikat der Comboni-Missionare in Kinshasa (DR Kongo). Hier waren die Schwierigkeiten zahlreich und nervenaufreibend. Die Sprache war französisch, die Atmosphäre war französisch, alles schmeckte und roch nach Frankreich, und ich konnte mich nicht anpassen. Ich hielt es nur zwei Jahre aus, dann gab ich auf und beschloss, nach Südafrika zurückzukehren, denn ich beabsichtigte, die Vorstellung, Missionar zu werden, ganz aufzugeben.
Der Provinzobere der Comboni-Missionare und mein ehemaliger Ausbilder während des Postulats hatten jedoch nicht die Absicht, mich zu verlieren: Sie ermutigten mich, sagten mir, ich solle geduldig sein und nichts überstürzen. Sie boten mir an, in der Comboni-Gemeinschaft der Pfarrei St. Peter Claver in Mamelodi, einem Vorort von Pretoria, zu leben.
Dort, in einer gastfreundlichen Gemeinschaft und umgeben von meinen eigenen Leuten, erholte ich mich und gewann mein Zutrauen zurück. Zwei Jahre später kehrte ich mit neuem Elan nach Kinshasa zurück. Ich nahm mein Theologiestudium wieder auf, das ich im Jahr 2010 abschloss. Am 7. August desselben Jahres legte ich in der Pfarrei Glen Cowie in der Provinz Limpopo, Südafrika, meine Ewige Profess ab. Am 22. August wurde ich zum Diakon geweiht, und am 12. Februar 2011 folgte in meiner Gemeinde in Masikwe die Priesterweihe.
Ich bat nur um zwei Monate Familienurlaub und erreichte im April mein neues Ziel, den Tschad. Seitdem habe ich eineinhalb Jahre in einer Mission in der Diözese Lai gearbeitet, dann weitere eineinhalb Jahre in der Pfarrei St. Franz von Assisi in der Diözese Doba. Im September 2014 wurde ich in die Pfarrei St. Michael in Bodo, ebenfalls in der Diözese Doba, versetzt, wo ich immer noch tätig bin.
Es gibt zwei große Herausforderungen: das Klima (wenn es im Tschad heiß ist, ist es wirklich heiß, und wenn es regnet, schüttet es) und die Sprache. Sowohl in Sambia als auch in der DR Kongo war ich ganz gut zurechtgekommen, weil die Menschen Bantu-Sprachen sprachen. Aber im Tschad sprechen die Menschen, abgesehen vom Französischen, das mir immer Kopfschmerzen bereitet hat, verschiedene Sprachen, die alle zu einer anderen Sprachfamilie gehören. In der ersten Gemeinde, der ich zugeteilt wurde, gab es vier lokale Sprachen: Besmé, Marba, Khabalayé und Ngambayé, die alle sehr schwierig sind und sich voneinander unterscheiden. Wie Sie vielleicht schon erraten haben, bin ich weder ein Linguist noch mehrsprachig.
Es ist immer noch mein größtes Handicap, dass ich nie in der Lage war, eine lokale Sprache wie ein Einheimischer zu sprechen. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Ich kann mich verständigen und ich verstehe die Menschen, auch weil ich ihnen mit den Augen und dem Herzen „zuhöre“. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich habe den Eindruck, dass auch sie gerne mit mir zusammen sind.
Und so engagiere ich mich hier in den Bereichen Erstevangelisierung, menschliche Förderung, Ausbildung von lokalen Führungskräften und dem gemeinsamen Bemühen darum, dass die Ortskirche sich selbst versorgen kann. Ich bin gerne hier. Ich fühle, dass ich dort bin, wo Gott mich haben will. Es gibt keine größere Freude. Die Schwierigkeiten der Vergangenheit – und es waren viele – erscheinen mir heute wie kleine Perlen in der Krone der Kirche von Afrika, als deren demütiger Diener ich mich fühle.
Comboni Missionaries‘ Team