Bruno Frank (61), Malermeister, stammt aus Stimpfach-Rechenberg, zehn Kilometer von Ellwangen entfernt. Nach Krankheit und Operation orientierte er sich neu und wurde ehrenamtlicher Mitarbeiter der Comboni-Gemeinschaft in Matany.“ Aus Matany in Uganda berichtet er von seinem neuen Leben.
Matany
Jetzt bin ich bereits im fünften Jahr hier im St. Kizito Hospital in Matany in Uganda, 1200 Meter über dem Meeresspiegel in der Region Karamoja, in der heißesten, trockensten und ärmsten Region im Nordosten des ostafrikanischen Landes Uganda. Die nächstgrößere Stadt ist Moroto, vierzig Kilometer entfernt an der Grenze zu Kenia. Dort befinden sich der nächste Bankschalter und das Postfach für das Krankenhaus.
In Moroto liegt auch der Bischofssitz. Unser Bischof, Damiano Guzzetti, ist Comboni-Missionar und kommt aus Italien. Mir als Maler gefällt besonders, dass er eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker hat. In Soroti, 140 Kilometer südwestlich von Matany, kann man Medikamente und Lebensmittel kaufen. Soroti hat einen gut bestückten Markt für Gemüse und Früchte. Aber auch Joghurt ist dort erhältlich, und das in einer sehr guten Qualität.
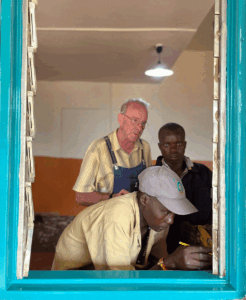
Erfahrung und Lernbereitschaft auf beiden Seiten – so kommt man gemeinsam zum Ziel. Foto: Gudrun Marat
Erste Erfahrungen
Begonnen hat für mich alles im April 2017 mit einem vierwöchigen „Erkundungsbesuch“. Das erste Mal war ich in einem für mich wirklich fremden Land und in einer fremden Kultur. Die Menschen hier sind offen und uns „Wazungu“ („Weiße“ in der Swahili-Sprache in Ostafrika) gegenüber sehr freundlich.
In Uganda gibt es sehr leckeres Essen – für die, die es sich leisten können. Bei uns im Laien-Missionar-Haus gibt es einmal die Woche Fleisch und einmal Fisch, ansonsten Gerichte mit verschiedensten Hülsenfrüchten und viel frischem Gemüse, auch Obst vom Markt. Ein echter Genuss ist der ugandische Kaffee. Bei den Comboni-Schwestern gibt es zweimal im Jahr Lasagne, an Ostern und Weihnachten, eine der leckersten, die ich je gegessen habe. Was ich aber ein bisschen vermisse, ist Schwarzbrot.
Aufbruch nach Uganda
Den so genannten „Kulturschock“ hatte ich in diesen vier Wochen jedoch nicht erlebt. Anfang Mai 2017 bin ich nach Deutschland zurückgeflogen und habe mit meinen drei Geschwistern alles rund ums Haus für die Vermietung erledigt. Am 27. November 2017 kehrte ich dann nach Matany zurück.
Ich bin im Bauhof (Technical Department –TD) des Krankenhauses als Letztverantwortlicher eingesetzt. Das „TD“ hat etwa vierzig fest angestellte ausgebildete Handwerker und acht „Casual workers“ (Tagelöhner), ohne Arbeitsvertrag. In der Technischen Abteilung des Matany-Krankenhauses gibt es etwa siebzig verschiedene Aufgabenbereiche, aufgeteilt in sieben Hauptbereiche: Maurer, Schreiner/ Zimmerleute, Elektriker, Installateure, Schlosser, Mechaniker/Fahrer und
Forstarbeiter. Rein rechnerisch kommen auf einen Hauptbereich zehn untergeordnete Teilbereiche.

Ein Teil des Bauhof-Teams vom Krankenhaus in Matany. Foto: Gudrun Marat
Meine Aufgabe
Zusammen mit den Teamleitern der verschiedenen Gewerke plane und organisiere ich die Arbeiten und bestelle und überwache erforderliches Material. Körperliche Arbeiten darf ich – verletzungsbedingt – nicht machen. Die Umstellung vom aktiven Handwerker zum Theoretiker war nicht einfach. Aber – ich bin wieder dabei und nicht mehr übrig wie in Deutschland! Zuhause in Deutschland war ich mit 55 Jahren zu „alt“ und als Handwerksmeister „überqualifiziert“!
Meine Aufgabe ist sehr umfangreich, abwechslungsreich und hoch interessant. Hier werden Dinge wieder repariert, die in Deutschland im Abfall landen. Fehlt ein bestimmtes Werkzeug oder Ersatzteil, wird es selber hergestellt. Für einen Handwerker/Tüftler ist das hier das reinste Paradies, und jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Im Großen und Ganzen habe ich mir die Arbeit schon so ähnlich vorgestellt. Aber das Improvisieren und nach einer Lösung suchen, wo es aussichtslos erscheint, haben wir in Deutschland irgendwie verlernt. Für rüstige Rentner, die noch mobil sind, ist das bestimmt eine interessante Sache, hier mal ein bis zwei Monate mitzuarbeiten und unsere Arbeiter zu schulen. Aber auch für jüngere Menschen, die noch im Berufsleben stehen. Dies nur als kleine Anmerkung.

Mutter und Kind werden im Krankenhaus in Empfang genommen. Die Geburt fand unterwegs statt. Foto: SKHM
Im Rettungsdienst
Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist der Rettungsdienst. Das war für mich auch Neuland. Da geht es oft runter von der Hauptstraße in den Busch raus. Solche schlechten, verschlammten, löchrigen Straßen habe ich vorher nur von Bildern gekannt. Da kommen die Landcruiser und der UNIMOG sehr oft an die Grenzen. Wenn dann noch eine schwangere Frau auf der Trage liegt, durchgeschüttelt wird und vor Schmerzen schreit, da war ich nicht nur einmal geschockt. Das geht durch Mark und Bein!
Unsere Patienten holen wir in so genannten Gesundheitszentren ab, nicht an den Privathäusern. Im Moment fahren wir sechzehn dieser Zentren an. Das nächste Zentrum in Lokopo ist etwa zwölf Kilometer entfernt. Zum am weitesten entfernten in Apeitolim fährt man achtzig Kilometer. Bei Regen mit Umweg knapp über hundert Kilometer. Auch bei Nacht! Da dauert die Anfahrt schon mal bis zu zwei Stunden! Patientinnen der Geburtshilfe und der Kinderstation werden kostenfrei transportiert. Alle anderen müssen einen Pauschalbetrag zwischen fünf und 12,50 Euro bezahlen. Die Fahrer sind normalerweise alleine unterwegs. Nur bei Nachtfahrten fährt immer einer der Wachmänner mit, und bei Fahrten zur Geburtshilfe ist immer eine Hebamme dabei. Da kommt es schon mal vor, dass der Fahrer bei der Rückfahrt anhalten muss, um der Hebamme bei der Entbindung behilflich zu sein!
Bei Verkehrsunfällen fahren wir die Unfallstelle direkt an. Seit 2020 ist die komplette Hauptstraße von Soroti bis Moroto komplett geteert. Dazu auch die Seitenstraße, die von der Hauptstraße bis Matany Ortsende führt. Bruder Günther hatte lange vorher schon gesagt: „Wenn die Straße nach Matany mal geteert ist, wird auf die Chirurgie viel Arbeit zukommen“. Er hat Recht behalten. Auf der kurzen Zubringerstrecke vom Highway nach Matany hat es in den ersten sieben Monaten acht tödliche Unfälle gegeben.

Segnung eines neuen Fahrzeugs, das für den Rettungsdienst ein wahrer Segen ist. Foto: Ernst Zerche
Wir haben ohnehin schon viele Patienten durch Gewalteinwirkung, Schussverletzungen (Kugeln, Pfeile und Speerspitzen) und jetzt noch vermehrt Verkehrsopfer. Die sehen zum Teil furchtbar aus. Das Schlimmste sind die Motorradunfälle. Die Fahrzeuge sind technisch in äußerst prekärem Zustand, die Fahrer/Beifahrer (bis zu fünf Personen/Kinder) ohne Helm, dann der raue Asphalt. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Auch in einem solchen Fall war der Fahrer des Krankenwagens bis vor kurzem allein (!) unterwegs, ohne Notarzt oder Pflegekraft. Inzwischen fährt bei Unfällen jetzt immer eine Pflegekraft mit.
Nie als Fremder gefühlt
Als ich hierher nach Matany gekommen bin, hatte ich eine sogenannte „Wunschliste“ im Kopf. Diese gibt es schon lange nicht mehr. Ich habe sehr schnell erkannt, dass vieles, was wir in Deutschland als wichtig ansehen, hier absolut unwichtig ist. Vieles vor Ort erinnert mich aber an meine Kindheit, an das einfache Leben ohne Fernseher, ohne Stereoanlage und ohne Werbezeitungen am Samstag. Da sitzen wir hier bei mir im „Laien-Missionar-Haus“ fast jeden Samstagabend zum „Sundowner“ (Dämmerschoppen) zusammen: Bruder Günther, der Chefarzt, die leitende Krankenschwester oder Besucher aus unserem Gästehaus (Ärzte aus Deutschland, Italien oder Firmenmitarbeiter, die Geräte warten oder installieren).
Was ich ganz besonders schätze und genieße ist der Abend, wenn es dunkel wird, diese Ruhe und Stille. Kein Straßenlärm, nur die Grillen zirpen und in der Regenzeit quaken die Frösche. Da merkt man erst, wie „laut“ auch unsere kleinen Dörfer in Deutschland sind. Diese Ruhe hat mir von Anfang an gutgetan, ich kann auch bei Zimmertemperaturen von knapp 30 Grad Celsius sehr gut schlafen.

Bruno Frank während eines Online-Gesprächs. Foto: Gudrun Marat
„Weiter so!“
Bei meinem Besuch in Deutschland 2020 besuchte ich Kollegen und gute Bekannte. Sie alle sagten mir: „Du bist als stressgeplagter, kranker Mann nach Afrika gegangen und als ausgeglichener, gesund aussehender Mann zurückgekommen.“ Als ich meinen Hausarzt aufsuchte, sagte er mir, er erkenne mich nicht wieder – im positiven Sinne. „Mit diesem Schritt haben sie etwas hinbekommen, was viele mit Tabletten und Arztbesuchen nicht schaffen.“
Seit 2000 (nach einer verschleppten Grippe mit Herzmuskelentzündung) musste ich jährlich zum Kardiologen zu einer Ultraschalluntersuchung des Herzens und zum EKG. Nun war ich im Mai 2020 das erste Mal seit 2016 wieder bei ihm. Nach der Untersuchung rief er mich in sein Sprechzimmer, was ich denn gemacht hätte? Er wisse nicht, was er sagen solle! Ich antwortete ihm, dass ich mich wohl fühle. Er erwiderte mir, dass seine Untersuchung das auch ergeben habe. Er habe mich noch nie so fit und ausgeglichen gesehen. Also erzählte ich ihm meine Geschichte. Angefangen mit der zweiten kaputten Schulter und der OP, von der Aufgabe meines Berufs von heute auf morgen, der erfolglosen Arbeitssuche, da ich zu alt und überqualifiziert sei, und von der Angst, in der Psychiatrie zu landen. Dann mein neues Leben im ugandischen Busch, meine neue Aufgabe im St. Kizito Hospital in Matany. Und jetzt, vor wenigen Wochen, die Operation der anderen Schulter.
Er schaute mich groß an und meinte: „Ich muss ihnen sagen, Sie haben alles richtiggemacht. Sie haben ihr Leben komplett entrümpelt, haben den Druck rausgenommen, hatten den Mut, einen solchen Schritt zu wagen. Das gelingt nur sehr wenigen Menschen, Sie sind einer davon. Halten sie daran fest!“ In den Arztbrief für meinen Hausarzt hat er ganz unten zusammenfassend geschrieben: „Weiter so!“
Bruno Frank
