Pater Franz Weber widmet sich im vierten Teil unserer Reihe dem Thema der “Dienstämter” in der Kirche und ist der Meinung, dass der Dienst der Laien, vor allem Frauen, in ihren Gemeinden weltweit mehr Beachtung und Würdigung durch die Kirche finden muss.
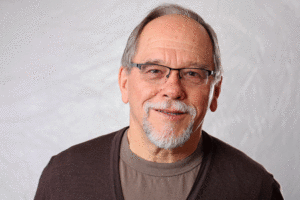
Pater Franz Weber. Foto: Raiimund Dörflinger
Den oben stehenden vielzitierten Satz von Bischof Jacques Gaillot kann man zweifellos auch in dem Sinn verstehen, dass unsere Kirche und ihre Mission heute nur dann glaubwürdig erscheinen, wenn sich in ihr Menschen vorbehaltlos und mit Freude für ihre Mitmenschen „in Dienst nehmen“ lassen. Als Missionare bewegt es uns sehr, wie viele hierzulande die Freude am christlichen Glauben verlieren und unserer Kirche in großer Zahl den Rücken kehren. Man gewinnt da und dort den Eindruck, dass manche Pfarreien sich in einem Sterbeprozess befinden, der unaufhaltsam voranschreitet. Umso mehr freut es uns, wenn wir in anderen Pfarreien eine lebendige Liturgie erleben, wo kein Priester mehr am Ort wohnt. Wo sich Menschen verschiedenen Alters für Aufgaben und Dienste zur Verfügung stellen – dort ist ein Hauch von Lebendigkeit zu spüren, der die Kirche vielleicht auch für Fernstehende wieder interessant und anziehend macht.
Nah dran
Eine Kirche, die am Leben bleibt, weil sie nah am täglichen Leben der Menschen „dran“ ist, eine Kirche der armen und einfachen Leute, die ihr Gottvertrauen nicht verloren haben und ihre Lebensfreude auch im Gottesdienst mit Musik und Tanz zum Ausdruck zu bringen: Solche Gemeinden haben viele von uns in ihrer Mission in Afrika oder in Lateinamerika hautnah erlebt. Dabei hat es dort nicht an Konflikten und extremen Situationen von Armut und Elend gefehlt. Zwar gibt es volle Priesterseminare in Afrika und zahlreiche Missions- und Ordensberufe, aber für viele der bevölkerungsreichen Pfarreien an den Randgebieten der Megastädte und für die ausgedehnten Landpfarreien stehen nach wie vor oft zu wenig Priester zur Verfügung.

Kleine christliche Gemeinschaft in Kariobangi, Kenia. Foto: Reinhold Baumann
Viele kleine Gemeinden
Hier liegt die Chance für eine neue Form von Kirche, in der die Pfarrei aus vielen kleinen Gemeinden besteht, in denen Laien die pastorale Leitungsverantwortung übernehmen und ihre Fähigkeiten einbringen. Während in der Missionsgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vor allem aus Europa kommende Priester und Ordensleute die Träger der Evangelisierung waren, bot die Mission schon sehr bald nach dem 2. Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) ein ganz anderes Bild. Anonyme Großpfarreien boten Menschen, die im christlichen Glauben und in der Kirche Heimat und Halt für ihr Leben suchten, keinen Raum für erlebte Gemeinschaft und persönliches Engagement. So entstanden – auch auf Initiative von Missionaren und Bischofskonferenzen – in manchen Ländern Ostafrikas so genannte „Small Christian Communities“, die man verbreitet mit einem Wort aus der Swahili Sprache als „Jumuijas“ bezeichnete. Ein entscheidender Anstoß zur Bildung kleiner christlicher Gemeinden war aber vom lateinamerikanischen Bischofsrat in Medellín, Kolumbien (1968) ausgegangen, dessen Schlussdokument die christliche Basisgemeinschaft als „Kernzelle kirchlicher Strukturierung und als Quelle der Evangelisierung“ (Medellín 15,10) ansah, die in der Folgezeit in vielen Ortskirchen Lateinamerikas als pastorale Priorität gefördert wurde.

Tauffeier in Brasilien, geleitet von einer Frau. Foto: Roberto Sottara
Hoffnungsvolle Entwicklung
„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu“ (1 Kor 12, 4.11). Der Wiederentdeckung dieser urchristlichen Gemeindeerfahrung verdankt die Kirche von heute vielerorts, dass sie zum Leben gekommen und am Leben geblieben ist. Denn ob in den unzähligen Basisgemeinden in Lateinamerika oder in den Millionen kleinen christlichen Gemeinden in Afrika oder in anderen Teilen der Weltkirche: Überall sind Frauen und Männer im Geiste Jesu und seines Evangeliums am Werk. Sie trauen sich selbst etwas zu, weil sie in sich eine Berufung verspüren – und die Gemeinde betrauen sie mit ganz konkreten Aufgaben. In meiner Zeit in der Begleitung von Basisgemeinden im Amazonasgebiet und bei São Paulo habe ich vor allem Frauen erlebt, die die Gottesdienste geleitet, Kinder und Jugendliche auf die Sakramente vorbereitetet, die Kranken besucht und sich auch in sozialen Bewegungen engagiert haben.
Wie wichtig diese Dienstämter für die kleinen christlichen Gemeinden sind, wurde mir erneut bewusst, als ich vor Jahren die Gelegenheit hatte, mit Bruder Hans Eigner „Jumujias“ in Kariobangi am Rande Nairobis kennen zu lernen. Dort gibt es für die verschiedenen Bereiche des Gemeindelebens Dienste (engl. ministries), die man „Hudumas“ nennt: Frauen und Männer, die für die Liturgie, den Dienst an Kranken und Sterbenden, für die Begleitung der Familien, Kinder und Jugendlichen oder für die brennenden Fragen von „Frieden und Gerechtigkeit“ zuständig sind. Aber nicht nur dort, sondern in vielen Diözesen, vor allem in den Kirchen des Südens, ereignet sich eine hoffnungsvolle Gemeindeentwicklung, weil Frauen und Männer mit Freude und „ehrenamtlich“ ihren Schwestern und Brüdern „zu Diensten“ sind.
Wir wollen nicht pastorale Einzelkämpfer,
sondern gemeinsam mit anderen auf dem Weg sein.
Kirche in neuer Gestalt
Was das 2. Vatikanische Konzil als theologische Vision der Kirche als Volk Gottes entworfen hatte, haben Frauen und Männer als „Laien“ in vielen Formen des Dienstes in die Tat umgesetzt. Sie alle sind ein Geschenk, eine „Gnadengabe“ des Geistes an ihre Gemeinden. Als ob das Konzil damals bereits die pastoralen Notsituationen von heute vorausgesehen hätte, heißt es in der Kirchenkonstitution (12): „Solche Gnadengaben, ob sie nun von besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter und allgemeiner verbreitet sind, müssen mit Dank und Trost angenommen werden, da sie den Nöten der Kirche besonders angepasst und nützlich sind.“
Ja, wir sind in Not geraten, weil wir in Europa zu lange und fast krampfhaft an einer hierarchisch-klerikerzentrierten Gestalt von Kirche festgeklammert haben. Diese Unbeweglichkeit lässt zurzeit viele in Panik geraten, weil es allerorts an Priestern fehlt. Dass die traditionellen Weiheämter des Bischofs, Priesters und Diakons auch in Zukunft notwendig sein werden, steht für uns als katholische Kirche grundsätzlich nicht zur Diskussion. Ob diese Ämter aber nicht auch für Männer und Frauen, ob sie nun verheiratet sind oder nicht, offenstehen werden, darüber wird man auch weiterhin und dringend im Gespräch bleiben müssen.
Wir Comboni Missionare
bekennen uns in unserer Lebensform (Nr. 64) und aufgrund unserer weltkirchlichen Gemeindeerfahrungen dazu, dass wir in unserer Arbeit die schon vorhandenen Dienstämter fördern und neue entdecken sollen. Uns bewegt die Frage nach einer alternativen und teilhabenden Gestalt christlicher Gemeinde, die sich nicht „von oben“ aufbaut, sondern „von unten“. Wir wollen nicht pastorale Einzelkämpfer, sondern gemeinsam mit anderen auf dem Weg sein.
So haben wir auch keine Bedenken gegen Reformprozesse wie den synodalen Weg der Kirche in Deutschland. Wir begrüßen es, dass in den Synodalforen auch die längst notwendige Gewaltenteilung in der Kirche, die gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag der Kirche, aber auch die bisher verdrängte Frage der Dienste und Ämter von Frauen in der Kirche diskutiert werden. Wir können bezeugen, dass es in vielen der Gemeinden, in denen wir als Missionare arbeiten, gerade und in zunehmenden Maß Frauen sind, die viele pastorale Dienste übernehmen und durch ihren Einsatz wesentlich dazu beitragen, dass die Kirche nicht „ausgedient“ hat, sondern am Leben bleibt und immer wieder zu neuer Lebendigkeit erwacht.
P. Franz Weber
