Elektroniker oder Priester – beide wollen Licht in die Welt bringen und in Martin Saurs Fall trifft beides zu. Am 12. Juli wurde der ehemalige Elektroniker in Rottenburg von Bischof Gebhard Fürst zum Priester geweiht. Wir führten ein Interview mit ihm:
Herzlichen Glückwunsch zur Priesterweihe, nun sind Sie Vikar und werden bald Ihre erste Stelle antreten. Wohin wird es gehen?
Ab 12. September werde ich als Vikar in Heidenheim tätig sein. Die Ostalb ist eine sehr schöne Gegend, in der ich mich bestimmt wohl fühlen werde, und ich bin gespannt, welche Aufgaben dort auf mich warten.
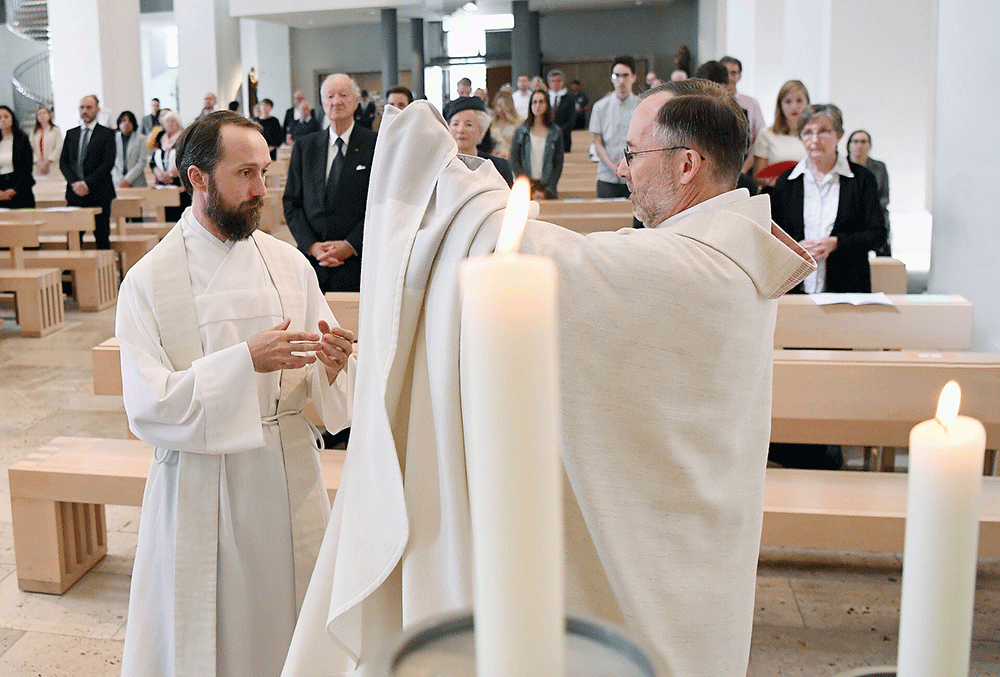
Priesterweihe in Rottenburg
Martin Saur erhält das Messgewand im Weihegottesdienst am 12. Juli 2020 im Dom St. Martin.
Foto: Pressefoto Ulmer/DRS
Welche Meilensteine würden Sie nennen, die für Sie auf dem Weg zum Priester entscheidend waren?
Es ist schwer zu sagen, wo es angefangen hat. Ein wichtiger Punkt war mit Sicherheit die Gemeindearbeit zu Hause. Unsere damaligen Pfarrer Michael Zips (kath) und Rudolf Spieth (ev) haben mich sehr inspiriert. Sowohl mit ihrer praktischen Arbeit, bei der wir viel zusammen gemacht haben, als auch mit ihren theologischen Gedanken.
Ein weiterer Meilenstein war dann die Zeit in Uganda und das Mitleben in der Gemeinschaft der Combonibrüder.
Das sind, glaube ich, die einzigen Meilensteine. Drumherum sind dann noch ganz viele Kieselsteinchen.
Über die Comboni-Missionare waren Sie von 2009 bis 2012 als Missionar auf Zeit in Afrika, genauer Uganda. Ein langer Zeitraum. Wie kam es dazu und was haben Sie dort gemacht?
Mit meiner Arbeit als Industrieelektroniker war ich von Anfang an nicht so richtig zufrieden. Es war gut zum Geldverdienen und die Menschen, die ich dabei kennenlernte, waren mir wichtig. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es zu wenig war. Es musste mehr geben, etwas, das meinem Leben einen tieferen Sinn geben kann.
Als eifriger Leser der Zeitschrift Kontinente war ich immer fasziniert von den Missionaren. Diese Menschen, die so viel für die Armen und Unterdrückten tun, waren für mich Persönlichkeiten, die etwas aus ihrem Leben gemacht haben. Es war ein stiller Wunsch in mir, selbst einmal als Missionar in Afrika tätig zu sein. Aber ich hätte mir das nie zugetraut, Missionar zu werden. Das war mir ein oder zwei Nummern zu groß. Bis dann in Kontinente der Artikel über „Missionar auf Zeit“ kam. Da war mir klar, dass ich etwas gefunden habe, was für mich passt. Ich habe dann den Kontakt mit den Combonis aufgenommen und eineinhalb Jahre später war ich in Uganda.
Weit im Nordosten Ugandas liegt Karamoja. Eine trockene Gegend mit wenig Infrastruktur und einem Volk, das als Halbnomaden lebt. Im St. Kizito Hospital gab es zwei Leute, die für die Instandhaltung der Elektrik verantwortlich waren. Mit mir waren es dann drei. Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis ich einen Überblick über die Elektroinstallation im Krankenhaus bekommen habe. Erst dann habe ich verstanden, was meine Aufgabe hier sein wird. Zusammen mit den anderen beiden Elektrikern habe ich dann viele Installationen erneuert, Solaranlagen gebaut, und viele Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Es war für mich eine sehr spannende und lehrreiche Zeit.
Hat sich ihr Bild von Afrika durch den Aufenthalt verändert?
In der Vorbereitungsphase habe ich viel über Afrika gelernt, schon das verändert das Bild. Aber wenn man mal vor Ort ist, dann ist es doch wieder ganz anders als man es sich vorgestellt hat. Ich verstehe jetzt nicht nur die Kultur, die Lebensweise, die Mentalität und die Probleme der Leute besser, sondern sehe auch Globalisierung, Ausbeutung und Themen wie Landgrabbing und nachhaltige Hilfe aus einem anderen Blickwinkel.
Ein Eintritt bei den Comboni-Missionaren war für Sie keine Alternative?
Natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, aber zum einen war meine persönliche Bindung zu Afrika nie so groß, dass ich für Jahrzehnte dort sein möchte, und zum anderen ist es für mich nicht attraktiv, in eine Gemeinschaft einzutreten, in der die meisten Mitbrüder wesentlich älter sind als ich.
Es ist nicht wichtig, zu wissen, wohin Gott uns führt,
wichtig ist nur zu wissen, dass er uns führt.
Wo begegnet Ihnen Jesus?
In jedem Menschen. Leider fällt mir das oft schwer zu begreifen. Wenn ich heute auf die vielen Begegnungen mit Jesus in Afrika zurückschaue, dann denke ich schon, dass ich vielen Menschen gegenübergetreten bin, als wären sie belanglose Nebenakteure in meinem Leben. Aber Jesus ist kein Nebendarsteller in unserem Leben. Er hat eine sehr wichtige Rolle, denn er ist der Garant für das Happy End.
Die Skandale der letzten Jahre in und um die Kirche haben viele Gläubige verunsichert. Wie begegnen Sie ihren Fragen?
Gerne würde ich diesen Fragen begegnen und mit den Gläubigen, oder auch den Nichtglaubenden, darüber ins Gespräch kommen. Aber diese Themen sind leider nur selten Gesprächsgegenstand. Diskussionen über Kirchenskandale erlebe ich meist nur unter hauptamtlichen Mitarbeitern. Für andere Leute sind Themen wie Flüchtlingskrise, Klimakrise und Coronakrise einfach viel präsenter.
Was wären Sie, wenn Sie kein Priester geworden wären?
Vielleicht wäre ich Elektroniker geblieben. Nach meiner Rückkehr aus Afrika habe ich ein Dreivierteljahr im Pflegeheim gearbeitet. Ich hätte mir auch eine Ausbildung zum Altenpfleger vorstellen können. Seit ich neulich bei einem Erste-Hilfe-Kurs war, würde mich Rettungssanitäter reizen. Vielleicht reicht es mir ja noch zum Notfallseelsorger.
Meine Berufung zum Priester verstehe ich nicht exklusiv, also, dass mein Leben nur als Priester gelingen kann, und alles andere nicht das ist, wozu Gott mich in die Welt gesetzt hat. Berufung bedeutet für mich, dass ich mich für eine von mehreren Möglichkeiten entschieden habe und dabei sehen muss, dass mein Leben gelingt.
Die Gottesdienstbesucher werden weniger. Lohnt es sich noch, Priester zu werden? Wo sehen Sie Ihre Berufung dabei?
Das ist die Frage der Kirche des 21. Jahrhunderts. Im 19. Jh. hätte man fragen können, ob es sich nach der Säkularisation noch lohnt, Priester zu werden. Im 16. Jh. hätte man aufgrund der Reformation fragen können, ob es sich noch lohnt. Im 12. Jh. waren die Kreuzzüge Grund derselben Frage. Im 7. Jh. der Ansturm des Islam auf Europa. Im 5. Jh. die Auflösung des Weströmischen Reichs und im 3. Jh. die Christenverfolgung. Ob es sich gelohnt hat, Priester zu werden, sollte man nicht vor dem Silbernen Priesterjubiläum fragen.
Da wir in den Gemeinden die Menschen immer weniger erreichen, sehe ich meine Berufung vielleicht mehr in der Kategorialseelsorge. Die Notfallseelsorge ist zum Beispiel ein Bereich, in dem die Kirche ihrer dienenden Bestimmung nachkommen kann. Menschen in ihrer aktuellen Not zu helfen, egal ob sie katholisch, evangelisch, muslimisch oder nicht gläubig sind, liegt mir sehr am Herzen. Dabei geht es nicht darum, sie zu bekehren, sondern ihnen zu helfen, über die Notsituation hinweg zu kommen. Passend dazu habe ich auch meinen Primizspruch gewählt: „…nicht Herren über euren Glauben, sondern Helfer zu eurer Freude“ (2 Kor 1,24).
Um ein anderes Beispiel zu nennen, möchte ich auf den Pfarrer in Merklingen hinweisen. Der macht nur noch 50 Prozent Gemeinde und treibt nebenher einen Bauernhof um. Da können Leute ein paar Tage kommen und nach dem benediktinischen Gedanken Ora et Labora (bete und arbeite) leben. Er ist evangelischer Pfarrer, denn mit der katholischen Kirchenstruktur wäre das nicht möglich, dass ein Pfarrer so etwas macht. Aber wie meine Aufgabe als Priester in der Kirche Gottes in zehn oder zwanzig Jahren aussehen wird, kann heute ohnehin noch niemand sagen, und das ist, glaub ich, auch ganz gut so. Es ist nicht wichtig, zu wissen, wohin Gott uns führt, wichtig ist nur zu wissen, dass er uns führt.
Interview: Ulrike Lindner
