Ulrike Lindner und Pater Reinhold Baumann sprachen mit dem ältesten und dem jüngsten Mitglied der Hausgemeinschaft in Ellwangen, Pater Dr. Josef Pfanner (93) und Pater Markus Körber (49) über ihren Weg zu den Comboni-Missionaren und wie sie heute darüber urteilen.
Wie bist Du zu den Comboni-Missionaren gekommen?
Pfanner: Ich stamme aus Scheffau im Allgäu, direkt an der Grenze nach Österreich und in Nachbarschaft zur Heimat von Abt Franz Pfanner, dem Gründer der Missionare von Mariannhill. Ich stamme aus einem katholischen Elternhaus und bin das dritte von acht Geschwistern. Nach der Grundschule machte ich zusammen mit meinem Bruder Albert eine Bäckerlehre. Unser Meister war ebenfalls ein engagierter Christ und ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten.
Gegen Ende des Krieges wurde ich noch zum Kriegsdienst eingezogen. Ich wurde gedrängt, zur SS zu gehen. Das wollte ich absolut nicht, und weil es fast keine andere Alternative gab, meldete ich mich zur Marine, obwohl ich damals noch nicht einmal schwimmen konnte. Ich wurde in eine Spezialschule geschickt, wo ich für ein Einmann-U-Boot ausgebildet werden sollte. Doch die Anlage wurde rechtzeitig von den Engländern zerstört, und damit war der Krieg für mich praktisch zu Ende. Ich wurde bald aus der Gefangenschaft entlassen.
Daheim machte ich mir Gedanken über meinen weiteren Lebensweg und es kam der Wunsch auf, Missionar und Priester zu werden. Zuerst fragte ich bei den Steyler Missionaren nach, sie meinten aber, ohne Oberschule könne ich nicht Priester werden. Unser Kaplan machte mich dann auf die Comboni-Missionare aufmerksam, die in der Nähe meiner Heimat in Mellatz eine Niederlassung hatten. Dort machte man es mir schließlich möglich, in Bamberg das Abitur nachzuholen.
Nach dem Noviziat hatte ich Gelegenheit, in Rom zu studieren, wo ich mich auf Kirchenrecht spezialisierte und promovierte. Nach der Priesterweihe 1960 bekam ich Sendung nach Peru. Dort war den Comboni-Missionaren die Diözese Tarma anvertraut worden mit Pater Anton Kühner als Bischof. Die Oberen meinten, er brauche einen profunden Kenner des Kirchenrechts an seiner Seite, und so wurde ich zu ihm gesandt. Doch meine Hauptaufgabe dort war die Seelsorge in Tarma und in den Bergdörfern der weiteren Umgebung.
Die Fähigkeiten jedes Einzelnen zu fördern war mir ein großes Anliegen.
P. Josef Pfanner
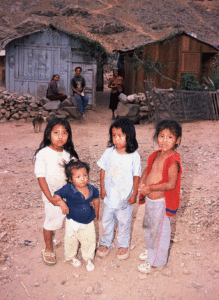
Kinder wiesen Pater Pfanner in Peru den Weg zu ihren Familien. Foto: Comboni-Press, Gianni Belesia.
1967 wählten mich die Mitbrüder in Peru zum Delegierten des Generalkapitels in Mellatz. Anschließend wurde ich zum Novizenmeister ernannt und fortan hatte ich fast immer eine Leitungsaufgabe in der Kongregation. Es war eine Zeit des Auf- und Umbruchs, die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ein besonderes Anliegen waren mir die Bruder-Missionare. Die Jüngeren von ihnen waren mit der bisherigen Situation nicht mehr einverstanden. Ich drängte darauf, dass sie eine bessere Ausbildung bekamen und dass ihre individuellen Begabungen und Wünsche berücksichtigt werden.
Körber: Ich stamme aus einem kleinen Dorf bei Pottenstein in der Fränkischen Schweiz in Oberfranken. Ich habe sechs Geschwister. Meine Eltern sind praktizierende Christen. Den Gedanken, vielleicht Priester zu werden, hatte ich zum ersten Mal mit etwa sieben Jahren. Im Laufe meiner Schulzeit interessierte ich mich für Umweltschutz und studierte nach dem Abitur Geoökologie, schon mit dem Ziel, später für ein paar Jahre in einem Land der „dritten Welt“ in der Entwicklungshilfe zu arbeiten. Globale Gerechtigkeit hat mich schon immer beschäftigt.
Während des Studiums habe ich verstärkt in der Bibel gelesen und nach meinem Abschluss dann konkret bei einigen Orden angefragt, bei den Jesuiten in Nürnberg, aber auch bei den Comboni-Missionaren, die eine Hausgemeinschaft in Bamberg hatten. Die Internationalität der Comboni-Missionare mit afrikanischen und lateinamerikanischen Mitbrüdern war für mich ausschlaggebend, in den Missionsorden einzutreten. Dort habe ich die katholische Kirche als wirklich universal, also die ganze Erde umfassend, erlebt. Das Noviziat absolvierte ich in Venegono bei Mailand und in Rom habe ich anschließend Theologie studiert.
Ursprünglich wollte ich nach Lateinamerika gehen, aber in dieser Zeit wurde mir bewusst, dass der Sudan das Land der Comboni-Missionare ist. Nach meiner Priesterweihe in Gößweinstein wurde ich auf meinen Wunsch hin dorthin geschickt.
Was hast Du vermitteln wollen? Wie waren Deine Erwartungen?
Pfanner: Ich habe mir gedacht: Christus ruft mich und ich gehe dorthin, wo er mich hinschickt, ich mache das, was von mir erwartet wird. Ich war dankbar, dass ich in Peru in der unmittelbaren Seelsorge arbeiten konnte, und lernte dort vor allem die Armen schätzen. Wir beobachteten Kinder, die bettelten, und merkten bald, dass ihre Eltern sich schämten, zu betteln. Mit einem Team in der Pfarrei besuchten wir mit den Kindern ihr Elternhaus und kamen so ins Gespräch mit vielen Menschen.
Später, als ich in Deutschland Novizenmeister wurde und in verschiedenen Hausgemeinschaften eine leitende Funktion hatte, da sah ich eben diese Aufgabe als meine Berufung. Es war die Zeit, als die Ordensregel, oder, wie wir heute sagen, Lebensform, neu formuliert wurde. Da gab es viel Gelegenheit zum Gespräch und zur Reflektion. Auch das war eine Arbeit, die mich besonders erfüllte. Ich denke, dass ich auch in meinem Einsatz für die Bruder-Missionare vieles bewirken konnte. Es war mir immer wichtig, dass jeder Mitbruder seine Begabungen, die ihm von Gott gegeben sind, einsetzen konnte. Diese Fähigkeiten jedes Einzelnen zu fördern, war mir ein großes Anliegen.
Die Internationalität der Comboni-Missionare war mit ausschlaggebend, in den Missionsorden einzutreten.
P. Markus Körber

Die Gemeinde in Tali, Südsudan, 2006 beim fröhlichen Empfang ihres neuen Pfarrers, Pater Markus Körber. Foto: Comboni-Missionare
Körber: Als ich 2006 im Südsudan ankam, habe ich erstmals erlebt, was Armut wirklich bedeutet. Auf der abgeschieden gelegenen Missionsstation in Tali, wo seit 1964 keine Missionare mehr waren, war ich die ersten zwei Monate zunächst allein mit den Einheimischen, bis ein italienischer Mitbruder dazukam. Ich erlebte, wie glücklich die Menschen waren, dass wieder ein Missionar bei ihnen war.
Für mich war und ist die Evangelisierung wichtig. Als Missionar säe ich den Samen des Wortes Gottes aus, indem ich aus meiner eigenen Kultur aufbreche und das Geschenk des Glaubens, das mir gegeben wurde, an andere Kulturen weitergebe. Die Jahre zwischen 2006 und 2011 waren im Sudan eine relativ friedliche Zeit – kein Bürgerkrieg – in der es leichter war, das Charisma Daniel Combonis weiterzutragen.
Was waren Höhepunkte, wo lagen die Schwierigkeiten in Deiner Tätigkeit?
Pfanner: Ich denke sehr gern an die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils zurück und überhaupt an die optimistische Aufbruchsstimmung in diesen Jahren. Ein besonderer Höhepunkt war dann die Wiedervereinigung mit den seit 1923 von uns getrennten italienischen Comboni-Missionaren im Jahr 1979. Bei diesem Prozess der Annäherung und Vorbereitung durfte ich eine tragende Rolle spielen. Schwierigkeiten und Enttäuschungen gab es natürlich auch, aber keine schwerwiegenden und dauerhaften.
Bevor ich 2018 nach Ellwangen kam, war ich Seelsorger in Graz-Messendorf und habe diese Aufgabe als sehr erfüllend empfunden. Mit den Menschen dort habe ich mich sehr verbunden gefühlt.
Weil ich grundsätzlich optimistisch veranlagt bin, konnte ich eigentlich nie „Nein“ sagen. Vielleicht sind die Menschen mit ihren Anliegen auch deshalb gern auf mich zugekommen.

Im Dialog: Pater Körber beim Gottesdienst in Tali, Südsudan. Foto: Comboni-Missionare
Körber: Geholfen hat mir die wirklich gute Zusammenarbeit mit der Ortskirche. Außerdem lernte ich langsam die Sprache, arrangierte mich mit meiner neuen Umgebung. Es gab kein Radio, kein Licht. Man musste zum Beispiel immer auf der Hut sein, wenn man sich draußen hinsetzte, um nicht von einem Skorpion gebissen zu werden.
Natürlich gibt es auch viel Ungerechtigkeit, doch die Menschen setzen ihre Hoffnung in die Kirche. Wir versuchen vor allem auch das Thema Nächstenliebe zu vermitteln, was angesichts der vielen Konflikte zwischen den Stämmen nicht leicht ist. Zu versuchen, den Teufelskreis der weit verbreiteten Blutrache aus dem Glauben heraus zu durchbrechen, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Andererseits habe ich selten so viel Demokratie erlebt wie dort. Wenn eine Frage aufkommt, setzt man sich hin, es wird diskutiert, hin und her, abgewogen, und am Ende kommt ein Auftrag heraus. Dabei werden übrigens auch die jungen Menschen angehört.
Die Armut und das Elend kamen mir immens vor. Ich denke dabei an das Wort „Misericordia“, das sich aus den Worten Misere = Elend und Cor=Herz zusammensetzt. Mir ging sozusagen angesichts des Elends der Menschen das Herz auf. Aber ich merkte auch, dass der Hunger nach dem Wort Gottes groß ist, ebenso der Wunsch nach Bildung. Indem wir versuchten, für Bildung und Glaubensunterweisung zu sorgen, wie zum Beispiel durch Fortbildungen für die Katechisten, wollten wir christliche Werte vermitteln.
Besonders schöne Momente habe ich bei Taufen erlebt – das Lächeln der Kinder, wenn ich ihnen das Wasser über den Kopf goss. Aber auch das abendliche Beieinandersein in der Dunkelheit, wenn die Menschen mit Inbrunst neu gelernte Lieder einüben und darüber die alltäglichen Herausforderungen vergessen können, war schön. Trotz aller Sorgen fühlt man sich selten allein.
Was möchtest Du anderen mit auf den Weg geben?
Pfanner: Immer offen zu sein für den Weg, den Gott mir weist.
Körber: Ich habe in der Mission erfahren, dass Menschen sich tief im Innern alle sehr ähnlich sind, egal, wohin man geht. Es ist die Art, wie man sich begegnet, die wichtig ist. Mit Respekt und Achtung vor der Würde des Einzelnen. In Tali im Südsudan war am Anfang ich der Arme. Wenn man dann ohne große Ansprüche an die neuen Aufgaben herangeht, kommt man am besten voran.
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs: In unserer Kongregation gibt es immer weniger europäische, dafür umso mehr afrikanische Mitbrüder. Unsere Deutschsprachige Provinz ist zwar überaltert, dennoch hat sie aufgrund ihrer Geschichte und Kultur etwas Wertvolles von ihrem theologischen Reichtum und ihrem ökumenischem Miteinander weiterzugeben.
Interview: Ulrike Lindner/Reinhold Baumann
